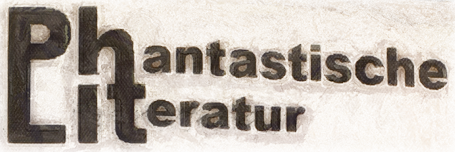Bis vor Kurzem wusste ich von diesem sehr verstörenden und surrealen Film überhaupt nichts. Dabei verehre ich Isabelle Adjani sehr und mag auch mehrere Filme von Regisseur Andrej Zulawski - manchmal entgehen einem die Perlen dann aber einfach doch. Umso schöner, sich noch überraschen lassen zu können.
Als ich hörte, es handele sich bei Possession um einen im geteilten Berlin spielenden, mit kafkaesken Momenten und sexueller Entgrenzung aufgeladenen Monsterfilm, konnte ich mir das zunächst gar nicht recht denken. Ich wurde eines Besseren belehrt. Die Prämisse ist dabei schnell erzählt: Der junge Mark (gespielt von Sam Neill) arbeitet offenbar für eine staatliche Institution, vermutlich für irgendeinen Geheimdienst. Er lebt mit seiner Frau Anna (Isabelle Adjani) und dem kleinen Sohn Bob in einer West-Berliner Wohnung. Doch die Ehe läuft nicht gut, da Mark wenig zuhause ist und Anna sich in der Situation sichtlich unwohl fühlt. Als Mark erfährt, dass Anna eine Affäre unterhält, setzen sich die Ereignisse in Gang.
Zwar gibt ein grobes Gerüst die narrative Marschrichtung vor, aber einen wirklichen Plot treibt Zulawski hier nicht voran. In dem über zwei Stunden langen Film zählt eher das ästhetische und emotionale Erlebnis, und beides brachte mich beim Schauen doch sehr an meine Grenzen.
Steadycam-artig folgt Kameramann Bruno Nuytten den Protagonisten durchs geteilte Berlin. Die Stadt selbst ist ein eigener ästhetischer Faktor, viele Szenen spielen in Kreuzberger Straßen, in Altbauwohnungen und Altbau-Treppenhäusern, oder gleich direkt an der Mauer. Die Stimmung, die durch den spezifischen Look in Verbindung mit typischer, durch minimale Kniffe evozierte Cold-War-Paranoia entsteht, ist einmalig.
Der Film öffnet von Szene zu Szene neue Assoziationsräume und lässt viel Platz für eigene Sinndeutungen. Die Diskontinuitäten des Gezeigten und die geringe Flächenhaftung der Handlung - bei der nie konkrete Informationen über Umstände o. ä. gegeben werden - laden dazu ein, den Film schlicht wirken zu lassen. Die Darsteller*innen sind ein Faktor, der sich in diese Deutung einreiht: Isabelle Adjani und Sam Neill spielen ihre Rollen derart borderlinig und erwartungsbrüchig, dass ich oft starke Nerven brauchte, um die intensiven Szenen durchzustehen. Auch der restliche Cast, der sehr überwiegend aus Deutschen besteht (die sehr bekannten Schauspieler Carl Duering und Heinz Bennent sind dabei), ist durchgehend überzeugend. Kunsttheoretisch könnte man sagen, dass sich Surrealismus und Expressionismus in den Darstellungen die Klinke in die Hand geben und dabei ziemlich brachial zu Werke gehen. Zackige Schnitte und Überblendungen verhindert oftmals die Orientierung, sodass man letztlich nicht genau weiß, ob Vorgänge nun wirklich geschehen sind oder der Einbildung der Charaktere entsprangen.
Der Film zieht die Gewaltschraube teils sehr an, ist auch oft eklig und abstoßend, gibt tiefe Blicke in psychische Zustände und ist immer wieder wirklich anstrengend. Dabei wird er aber nie billig oder exploitativ, entwickelt sogar eigene Formen der Sinnlichkeit. Durchzogen bleibt er dabei von einem nihilistischen Grundton, entfremdeter Anonymität und graublasser Tristesse, was gemeinsam umschlägt in eine reizvolle Mixtur, die ich so noch nirgends gesehen hatte. Ein dumpfer Synthie-Score, sparsam eingesetzt, tut sein Übriges. Das übernatürlich-monströse Element wird homogen eingewoben (Stichwort: Hentai-Ästhetik), am Ende schließt Zulawski gar wieder an klassische Genre-Motive an. Ein echter Trip abwärts.